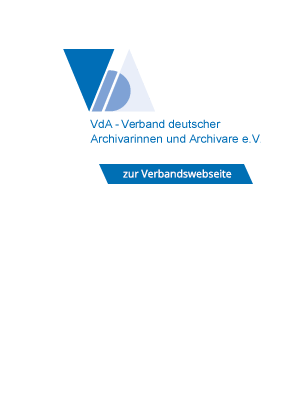Offener Brief des VdA an den Bayerischen Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst Dr. Ludwig Spaenle zur Verlegung des StA Würzburg
Sehr geehrter Herr Minister,
wie den Medien zu entnehmen war, plant die bayerische Staatsregierung, das Staatsarchiv für Unterfranken vom Sitz der Bezirksregierung in Würzburg nach Kitzingen zu verlegen.
Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. als Vertreter der fachlichen Interessen des deutschen Archivwesens verurteilt die geplante Verlegung scharf. Gemäß Artikel 6 Abs. 1 des Bayerischen Archivgesetzes haben alle staatlichen Behörden des Freistaates Bayern alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, dem zuständigen Archiv anzubieten. Im Fall der Bezirksregierung für Unterfranken ist das Staatsarchiv Würzburg zuständig. Durch die geplante Verlegung wird die bestehende enge Zusammenarbeit zwischen der Bezirksregierung und dem Staatsarchiv empfindlich gestört. Durch eine mögliche Verlegung nach Kitzingen sind die Mitarbeiter des Staatsarchivs Würzburg gezwungen, jedes Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung lange im Voraus zu planen, weil bei jedem Termin in Würzburg die Fahrt dorthin organisiert werden muss. Das führt zu erheblich mehr Aufwand und deutlich höheren Kosten, als wenn das Staatsarchiv in Würzburg ansässig bleibt.
Für den neuen Standort Kitzingen bringt das Staatsarchiv Würzburg, in dem 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, kaum Vorteile. Im Gegenteil. Die Arbeitsmarktsituation ist für Archivarinnen und Archivare derzeit sehr gut. Wenigen Absolventen stehen viele unbesetzte Stellen gegenüber. Es ist fraglich, ob es dem Staatsarchiv Würzburg in Kitzingen gelingt, sich gegen Standorte mit vielfältigerem Angebot im Wettbewerb um qualifizierte Archivarinnen und Archivare zu behaupten.
Auch die Zusammenarbeit mit dem Würzburger Wissenschaftsstandort wird durch die geplante Verlegung gefährdet. Während jetzt die Forscher von der Universität schnell und einfach Zugang zum Archivgut haben und ihre Forschungen ohne lange Fahrtwege im Staatsarchiv und den anderen in Würzburg ansässigen Archiven betreiben können, werden sie künftig, wenn die Verlegung realisiert wird, deutlich mehr Organisationsaufwand haben. Es ist fraglich, ob ein so anspruchsvoller Kundenkreis wie die wissenschaftlichen Nutzerinnen und Nutzer des Staatsarchivs Würzburg und die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen des Staatsarchivs Würzburg bereit sind, den Weg nach Kitzingen auf sich zu nehmen. Mit einem Staatsarchiv, dessen Bestände am neuen Standort kaum genutzt und dessen Veranstaltungen wenig besucht werden, ist auch dem strukturschwachen Kitzingen nicht gedient.
Dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare ist sehr wohl bewusst, dass die Unterbringung des Staatsarchivs Würzburg in der Residenz nicht den Anforderungen an ein fachgerechtes Archivgebäude entspricht. Für die fachgerechte Unterbringung des Staatsarchivs ist aber ein Standort in Würzburg sicher die bessere Wahl als in Kitzingen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Dr. Irmgard Christa Becker